Stell dir vor, ein leerstehendes Ladenlokal in deiner Nachbarschaft wird plötzlich zu einem Gemeinschaftsgarten, einem Pop-up-Café oder einer Kunstwerkstatt. Kein Wunder, dass solche Projekte immer beliebter werden. Doch hinter jeder temporären Nutzung steckt mehr als nur Kreativität - es steckt ein rechtlicher Rahmen, den du kennen musst, wenn du nicht auf Kosten von Bußgeldern oder Abrissandrohungen lernen willst.
Was ist eine temporäre Nutzung wirklich?
Temporäre Nutzungen, oft auch als Zwischennutzung bezeichnet, sind befristete Nutzungen von Immobilien, die nicht mehr in ihrer ursprünglichen Form genutzt werden. Das kann ein verwaistes Fabrikgebäude sein, ein leerstehendes Wohnhaus oder ein brachliegendes Grundstück. Der Schlüssel: Es gibt keinen Eigentümerwechsel. Der Raum bleibt im Besitz des ursprünglichen Inhabers, wird aber für eine begrenzte Zeit von jemand anderem genutzt - oft zu sehr günstigen Konditionen oder sogar kostenlos.
Diese Form der Nutzung ist kein Loophole, sondern ein bewusstes Instrument der Stadtentwicklung. Sie verhindert Vandalismus, hält Gebäude instand und bringt Leben in vernachlässigte Viertel. In Freiburg, Berlin oder Köln werden so leerstehende Gebäude zu Kulturzentren, in Hamburg zu Co-Working-Spaces. Die Dauer ist flexibel: Manche Projekte laufen drei Monate, andere fünf Jahre. Und manchmal, wenn die geplante Neunutzung ausbleibt, wird die Zwischennutzung zur Dauerlösung - ohne dass der Eigentümer etwas dagegen tun kann.
Rechtlich gesehen: Kein Sonderstatus
Eine der häufigsten Irrtümer: Man glaubt, eine temporäre Nutzung sei weniger reguliert als eine dauerhafte. Das ist falsch. Aus rechtlicher Sicht gibt es keinen Unterschied zwischen einer Zwischennutzung und einer normalen Nutzung. Alle Bauvorschriften, Brandschutzstandards, Barrierefreiheitsanforderungen und Nutzungsarten gelten genauso.
Wenn du ein ehemaliges Lagerhaus in eine Kreativwerkstatt verwandeln willst, brauchst du eine Baugenehmigung - genau wie bei einem Neubau. Die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes ist maßgeblich. In Baden-Württemberg, wo ich lebe, ist das Landesbauordnung (LBO) entscheidend. Dort muss jede Nutzungsänderung, selbst wenn sie nur vorübergehend ist, genehmigt werden, wenn sie die bauliche Nutzungsklasse verändert - etwa von Lager (Nutzungsklasse 4) zu Gewerbe (Nutzungsklasse 6).
Und auch der Brandschutz: Fluchtwege, Feuerlöscher, Rauchmelder - alles muss erfüllt sein. Kein Nachlass wegen „nur temporär“. Wer das ignoriert, riskiert nicht nur die Schließung, sondern auch Haftung bei Unfällen. Ein Brand in einer ungenehmigten Zwischennutzung kann teuer werden - für den Nutzer, den Eigentümer und die Gemeinde.

Zweckentfremdung: Wo ist die Grenze?
Wenn du eine Wohnung vermietest, aber nicht als Hauptwohnsitz, sondern als Büro, Atelier oder Ferienunterkunft, bist du dann ein Zweckentfremder? Nicht automatisch.
Das Gesetz verbietet nicht, Wohnraum anders zu nutzen - es verbietet nur, wenn die Wohnnutzung nicht mehr vorherrscht. Die Faustregel: Wenn weniger als 50 % der Wohnfläche für gewerbliche Zwecke genutzt werden - etwa ein Zimmer als Büro -, ist das legal. In Bayern darfst du deine gesamte Wohnung bis zu acht Wochen im Jahr an Touristen vermieten, ohne eine Genehmigung. In Berlin oder Hamburg hingegen gelten strengere Regeln: Hier brauchst du eine Erlaubnis, wenn du mehr als 60 Tage pro Jahr vermietest.
Wichtig: Ein kurzer Leerstand ist kein Verstoß. Wenn du deine Wohnung für ein halbes Jahr umbaust oder deinen Job wechselst, ist das normaler Marktverlauf. Aber wenn du die Wohnung jahrelang leerstehen lässt, um sie später teurer verkaufen zu können, kann das in manchen Städten als „absichtlicher Leerstand“ gewertet werden - und das ist ein anderes Thema, das mit der Wohnungspolitik zu tun hat.
Wer darf was nutzen? Die Rolle des Eigentümers
Der Eigentümer ist der Schlüssel. Ohne seine Zustimmung ist jede temporäre Nutzung rechtswidrig - egal wie gut die Idee ist. Viele Eigentümer scheuen sich, weil sie Angst vor Schäden, Haftung oder steuerlichen Folgen haben. Aber es gibt Lösungen.
Ein einfacher Mietvertrag mit klaren Bedingungen schützt beide Seiten: Dauer der Nutzung, Pflichten zur Instandhaltung, Haftung bei Schäden, Rückgabestatus. Viele Kommunen bieten sogar Musterverträge an. In Berlin gibt es die „Zwischennutzungsplattform“, die Eigentümer und Nutzer zusammenbringt - mit rechtlicher Absicherung.
Und was ist mit Steuern? Wenn du die Immobilie vermietest, auch nur temporär, musst du die Einkünfte versteuern. Kein Unterschied zu einer Dauermiete. Aber: Wenn die Nutzung kostenlos ist und keine wirtschaftliche Gegenleistung besteht, gibt es keine steuerpflichtigen Einkünfte - aber auch keinen Anspruch auf Abschreibungen. Das ist eine Abwägung, die du mit deinem Steuerberater klären solltest.
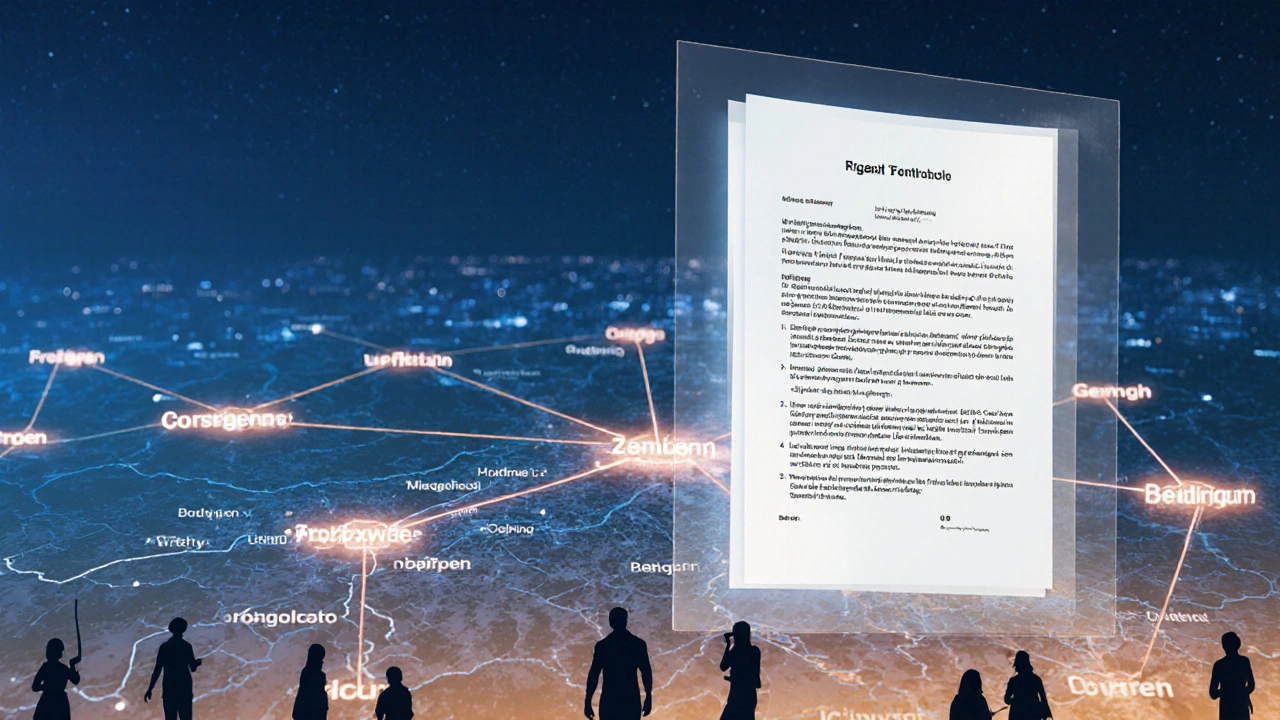
Praktische Hürden: Warum viele Projekte scheitern
Die Idee ist gut. Der Weg dorthin ist schwer. Viele Initiativen scheitern nicht an der Kreativität, sondern an der Bürokratie.
- Die Baugenehmigung dauert Monate - oft länger als die geplante Nutzungsdauer.
- Die Feuerwehr verlangt eine Brandschutzgutachten, das 3.000 Euro kostet - für ein Projekt mit 5.000 Euro Budget.
- Der Eigentümer hat Angst, dass er später für Schäden haftet, obwohl er nichts getan hat.
- Die Nachbarn klagen wegen Lärm - obwohl es nur ein kleiner Kunstworkshop ist.
Die Lösung: Frühzeitig mit der Bauaufsicht sprechen. Viele Städte haben mittlerweile „Zwischennutzungsbeauftragte“ - Ansprechpartner, die wissen, wie man mit Flexibilität und Sicherheit umgeht. In Freiburg gibt es einen solchen Ansprechpartner im Amt für Stadtentwicklung. Dort kannst du deine Idee vorstellen, bevor du einen Antrag stellst. Oft wird dann ein vereinfachtes Verfahren möglich - etwa ohne vollständige Baugenehmigung, wenn das Gebäude nicht verändert wird und nur geringe Risiken bestehen.
Die Zukunft: Professionalisierung und Rechtsklarheit
Die Zeiten, in denen Zwischennutzungen als „besetzte Häuser“ oder „kreative Randerscheinungen“ abgetan wurden, sind vorbei. Heute werden sie als strategisches Instrument der Stadtentwicklung gesehen. Die Bundesregierung hat das 2008 erkannt, die Stadt Berlin 2007 mit Leitlinien.
Heute gibt es spezialisierte Agenturen, die Zwischennutzungen vermitteln - wie „Leerstand macht Stadt“ in Köln oder „Zwischennutzung.de“ in Berlin. Sie verbinden Eigentümer mit Projekten, helfen bei Verträgen und klären rechtliche Fragen. Die Zukunft liegt in der Professionalisierung - nicht im Chaos.
Auch die Gesetze ändern sich. In Nordrhein-Westfalen wird aktuell ein Modellprojekt getestet, das temporäre Nutzungen von Dauerprojekten rechtlich trennt - mit vereinfachten Anforderungen, aber klaren Sicherheitsstandards. Das könnte ein Modell für ganz Deutschland werden.
Was bleibt? Temporäre Nutzungen sind kein Ausweg, sondern eine Chance - für Stadt, Eigentümer und Nutzer. Aber nur, wenn man sie mit Respekt vor den Regeln angeht. Kreativität braucht Rahmen - nicht Freiheit ohne Verantwortung.
Ist eine temporäre Nutzung ohne Genehmigung möglich?
Nein. Selbst wenn die Nutzung nur kurzfristig ist, gelten alle baurechtlichen Vorschriften. Ohne Genehmigung, wenn eine Nutzungsänderung oder bauliche Veränderung vorliegt, ist die Nutzung rechtswidrig und kann mit Bußgeldern oder Zwangsräumung enden. Ausnahmen gibt es nur bei sehr geringfügigen Änderungen - etwa wenn ein leerstehendes Lager nur als Lagerraum für private Gegenstände genutzt wird. Aber sobald du es als Café, Werkstatt oder Büro nutzt, brauchst du die Genehmigung.
Darf ich eine Wohnung als Ferienwohnung vermieten, ohne Genehmigung?
Das hängt vom Bundesland ab. In Bayern darfst du deine Wohnung bis zu 8 Wochen pro Jahr an Touristen vermieten, ohne Genehmigung - vorausgesetzt, es ist deine Hauptwohnung. In Berlin, Hamburg oder München brauchst du eine Erlaubnis, wenn du mehr als 60 Tage im Jahr vermietest. In einigen Städten ist sogar die Vermietung von nur 30 Tagen genehmigungspflichtig. Prüfe immer die lokale Wohnraumverordnung - sie variiert stark.
Was passiert, wenn ich eine Zwischennutzung nicht ordnungsgemäß beende?
Wenn du die Nutzung über die vereinbarte Zeit hinaus fortsetzt, wird sie zur ungenehmigten Dauernutzung. Der Eigentümer kann dich abmahnen, die Nutzung einstellen lassen und Schadensersatz verlangen. In manchen Fällen kann die Stadt auch die Rückbaupflicht auferlegen - also das Gebäude in den ursprünglichen Zustand versetzen. Das kann Tausende Euro kosten. Deshalb: Im Vertrag steht, wie die Rückgabe erfolgt - halte dich daran.
Kann ich als Mieter eine Zwischennutzung anfangen, ohne die Zustimmung des Eigentümers?
Nein. Selbst wenn du das Gebäude nicht besitzt, darfst du es nicht anders nutzen, als es im Mietvertrag steht. Wenn du eine Wohnung als Büro nutzt, ohne dass der Vermieter zugestimmt hat, verstößt du gegen den Mietvertrag. Der Vermieter kann kündigen - und das ist kein Risiko, das du eingehen solltest. Immer zuerst den Eigentümer fragen - schriftlich.
Wie finde ich einen Eigentümer, der eine Zwischennutzung zulässt?
Viele Kommunen haben Online-Plattformen, wo leerstehende Immobilien gelistet werden - etwa „Leerstand-Portal“ in Freiburg oder „Zwischennutzung.de“ in Berlin. Auch lokale Kulturämter oder Stadtteilzentren wissen oft, wo Leerstand besteht. Ein guter Ansatz: Gehe direkt zu den Immobilienverwaltern oder Hausverwaltungen in deinem Stadtteil. Viele wissen, dass Leerstand teuer ist - und sind offen für Lösungen, wenn du professionell und verlässlich wirkst.


Dagmar Devi Dietz
November 8, 2025 AT 23:57OMG ich hab so ein Projekt in meinem Viertel gesehen!! 🤩 Das alte Postamt wurde zu einem Kaffee- und Kunsttreff, und keiner hat was gesagt!! 😍
conrad sherman
November 10, 2025 AT 07:18ja klar… wieder so ein ‘kreatives’ projekt das nur wegen ‘kultur’ ausgeht… aber wenn man das bauamt fragt, dann ist das ‘zweckentfremdung’ und ‘feuergefährlich’… typisch deutsch… 😒
Walther van Berkel
November 11, 2025 AT 04:39Interessant, wie hier zwischen rechtlicher Formalität und sozialer Notwendigkeit gespalten wird. Temporäre Nutzungen sind keine Loopholes, sondern Ausdruck einer lebendigen Stadtgesellschaft. Sie füllen Lücken, die der Markt nicht schließt – und das ist kein Vergehen, sondern eine Form der Stadtentwicklung als gemeinschaftliche Praxis. Wer das nur als ‘Bürokratie’ abtut, versteht nicht, dass Orte auch sozialen Wert haben, nicht nur wirtschaftlichen.
Die Frage ist nicht ‘ob’ man genehmigt werden muss, sondern ‘wie’ man Prozesse so gestaltet, dass Kreativität und Sicherheit nicht gegeneinander arbeiten. Das ist die echte Herausforderung – nicht die Genehmigung an sich.
Ingrid Carreño
November 12, 2025 AT 01:48WUSSTET IHR DASS DIE STADT DAS ALLE BEHINDERT, DAMIT DIE IMMOBILIENSPERREN NICHT ZUSAMMENBRICHEN?? 😱 Die großen Investoren zahlen Milliarden, um leer zu halten – und jetzt kommt ihr mit euren ‘Kunstwerkstätten’ und denkt, das ist ‘nur’ eine Baugenehmigung?? NEIN. DAS IST KONTROLLE. DIE STADT WILL KEINE UNABHÄNGIGEN RÄUME. DAS IST EIN KONSPIRATIONSTHEORIE-LEVEL 10! 🤯
Maria Neele
November 12, 2025 AT 21:54Ich hab letztes Jahr mit einem Team ein altes Lager in Leipzig zu einem Nachbarschaftstreff gemacht. Die Feuerwehr hat uns erst 3 Monate gebraucht, um zu sagen: ‘Geht so, aber nur mit Rauchmeldern und einem zweiten Ausgang.’ Kein kompletter Umbau, kein teures Gutachten – nur klare Kommunikation.
Die meisten Ämter sind nicht böse, sie sind überlastet. Wenn du vorbeikommst, mit einem Plan, und nicht nur mit einer Petition, dann helfen die meistens. Einfach fragen. Nicht warten, bis alles perfekt ist.
Eirin Shu
November 13, 2025 AT 11:56Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind klar und nachvollziehbar. Es ist nicht erforderlich, dass jede Initiative eine vollständige Baugenehmigung erhält, wenn die Nutzungsänderung geringfügig ist. Die Verhältnismäßigkeit bleibt ein zentrales Prinzip des Verwaltungsrechts. Die Herausforderung liegt nicht in der Gesetzeslage, sondern in der Umsetzung durch lokale Behörden, die oft nicht über die nötigen Ressourcen oder die Schulung verfügen, um flexibel zu handeln.
jan kar
November 14, 2025 AT 23:35du schreibst ‘bauen’ aber meinst ‘nutzen’… und ‘zweckentfremdung’ ist nicht ‘nur’ wenn mehr als 50% gewerblich genutzt wird, das ist ein vollkommener falscher satz. du hast keine ahnung. die bauordnung sagt: jede nutzungsänderung muss genehmigt werden. punkt. nicht ‘wenn’… einfach immer. deine ‘faustregel’ ist gefährlich. du bringst leute ums geld. 😡
Terje Tytlandsvik
November 16, 2025 AT 20:45Ich hab neulich ein altes Bäckereigebäude in Oslo als Künstler-Café gesehen. Keine Genehmigung, aber die Stadt hat es einfach geduldet, weil es niemanden gestört hat. Die Leute haben es gemocht. Vielleicht brauchen wir nicht immer mehr Regeln… manchmal reicht es, einfach zu beobachten und zu warten.
🌱
Kaja St
November 17, 2025 AT 15:15Ich hab das mit der Ferienwohnung in München ausprobiert – 45 Tage im Jahr, ohne Genehmigung. Kein Problem. Aber als ich auf 58 Tage kam, kam die Stadt und hat mir eine E-Mail geschrieben: ‘Bitte melden Sie sich.’ Ich hab’s gemeldet. Keine Strafe. Nur eine freundliche Erinnerung.
Die meisten Ämter wollen nicht strafen. Sie wollen nur wissen, was los ist.
elsa trisnawati
November 19, 2025 AT 13:37Und dann… kommt der Eigentümer… und will… das ganze… wieder… zurück… und… verlangt… Schadensersatz… für… die… ‘Verschmutzung’… der… Wände… obwohl… sie… vorher… 10 Jahre… leer… standen… und… jetzt… plötzlich… ‘kaputt’… sind… weil… jemand… sie… benutzt… hat…
Günter Scheib
November 21, 2025 AT 06:48Ein wichtiger Hinweis: Die Rechtslage ist in den Bundesländern unterschiedlich, aber die Grundprinzipien der Bauordnung sind bundesweit einheitlich. Eine Nutzungsänderung, die die Nutzungsklasse verändert, bedarf immer einer Genehmigung – unabhängig von der Dauer. Der Begriff ‘temporär’ hat im Baurecht keine spezielle Bedeutung. Es handelt sich um eine Anwendung der allgemeinen Vorschriften. Wer das nicht versteht, riskiert nicht nur Bußgelder, sondern auch die Unmöglichkeit, später eine legale Nutzung zu etablieren.
Steffen Jauch
November 22, 2025 AT 21:55Ich hab mit einer Initiative in Köln gearbeitet – die hat ein leerstehendes Rathaus-Außenbüro zu einer Bibliothek gemacht. Die Stadt hat gesagt: ‘Keine Baugenehmigung nötig, weil keine baulichen Veränderungen.’ Aber: Brandschutz, Fluchtwege, Toiletten – das mussten sie machen. Kein Nachlass. Kein ‘nur temporär’. Und trotzdem: Sie haben es geschafft. Weil sie nicht ‘gegen’ die Behörden, sondern ‘mit’ ihnen gearbeitet haben.
Das ist der Schlüssel: Zusammenarbeit, nicht Konfrontation.
Matthias Baumgartner
November 24, 2025 AT 03:41Stoppt das Drama. Entweder du machst es legal – oder du machst es illegal. Kein Mittelweg. Wer sich auf ‘kreative Lösungen’ verlässt, wird später betrogen. Der Eigentümer kündigt. Die Stadt räumt ab. Du hast keine Rechte. Kein ‘aber’ – einfach nur Regeln. Folge ihnen. Punkt.
Edvard Ek
November 26, 2025 AT 00:30Es ist bemerkenswert, wie die öffentliche Wahrnehmung temporärer Nutzungen von einer romantischen Sichtweise – als kulturelle Rebellion – hin zu einer pragmatischen, institutionalisierten Form der Stadtentwicklung wandelt. Die früheren, oft anarchischen Initiativen sind heute Teil eines strukturierten Systems, das durch rechtliche Klarheit, professionelle Vermittlung und institutionelle Unterstützung geprägt ist. Diese Entwicklung ist nicht nur positiv, sondern unvermeidlich. Urbanes Leben erfordert Struktur – nicht nur Inspiration.
Die Herausforderung besteht nun darin, diese Systeme so zu gestalten, dass sie auch marginalisierte Gruppen einbeziehen – nicht nur gut vernetzte Kreative.
Nick Weymiens
November 26, 2025 AT 06:31Wie immer: Die Masse ist dumm. Sie denkt, ‘kreativ’ bedeutet ‘frei’. Aber Freiheit ist nur die Illusion derer, die nicht wissen, dass alles, was sie tun, von einem System kontrolliert wird – von Steuern, von Genehmigungen, von der Angst des Eigentümers. Die ‘Zwischennutzung’ ist nur ein weiteres Kapitel im Buch der Kontrolle. Wer das nicht sieht, ist kein Aktivist – er ist ein Spielstein.
Christian Seebold
November 27, 2025 AT 18:36Ich hab mal ein altes Ladenlokal in Stuttgart als Pop-up-Biergarten gemacht. 3 Monate. Keine Genehmigung. Die Feuerwehr kam, guckte sich um, hat ‘ne Flasche Bier getrunken und gesagt: ‘Macht weiter.’ Kein Problem. Aber als der Eigentümer rausgefunden hat, dass wir Gewinn gemacht haben, hat er uns gekündigt. Und die Stadt? Hat nichts gesagt. Weil keiner was gemeldet hat.
Manchmal ist es nicht die Regel – sondern die Menschen, die zählen.
Ulrike Kok
November 28, 2025 AT 12:05Leerstand ist eine Form von Kapitalverwertung – nicht von Verschwendung. Wer ein Gebäude nutzt, ohne es zu verkaufen, ist ein Aktivist. Wer es leer lässt, ist ein Investor. Und wer sich beschwert, weil jemand anderes Leben in den Raum bringt, hat einfach Angst vor Veränderung. Wir brauchen weniger Regeln – mehr Vertrauen. Die Stadt ist kein Büro – sie ist ein lebendiger Organismus. Und Organismen wachsen nicht in Excel-Tabellen.
Duquet Jean-Marc
November 29, 2025 AT 00:09Ja klar… die Stadt gibt uns ‘Zwischennutzungsplattformen’… wie ein Kind mit einem Spielzeug… das es nicht versteht… aber uns sagt: ‘Schau mal, ich hab was getan!’… während sie gleichzeitig die Mieten hochtreiben und die Leute aus den Vierteln vertreiben… das ist nicht Hilfe… das ist eine Show… eine Theateraufführung… mit dem Titel: ‘Wir kümmern uns’… aber in Wirklichkeit… kümmert sich niemand… nur die Leute, die es einfach machen… ohne Genehmigung… ohne Papier… ohne Angst…
Walther van Berkel
November 30, 2025 AT 21:01Die Reaktion von Christian Seebold ist typisch für eine Gesellschaft, die zwischen Idealismus und Realismus verloren geht. Es ist nicht ‘kein Problem’, wenn die Feuerwehr eine Flasche Bier trinkt – es ist ein Zeichen dafür, dass die Institutionen nicht darauf vorbereitet sind, mit kreativen, informellen Lösungen umzugehen. Das Problem liegt nicht bei den Initiativen, sondern bei einem System, das keine Mechanismen hat, um flexibel zu reagieren. Wir brauchen keine mehr Regeln – sondern eine andere Art der Regulierung: partizipativ, experimentell, lernend.